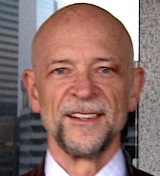Das Recht auf Eigentum - ein Menschenrecht?
Beitrag zum Philosophy Slam, Bamberg 2014
Zu den Menschenrechten, die im Grundgesetz und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 1948 der UNO, Art. 17, verankert sind, gehört auch das Recht auf Eigentum. Das heißt: es wird in eine Reihe gestellt mit dem Recht auf Leben, auf persönliche Freiheit, auf körperliche Unversehrtheit. Ist das Recht auf Eigentum wirklich genau so wichtig?
Wenn ich auf mich selbst blicke, finde ich es durchaus angenehm, dass es Dinge gibt, über die ich verfügen kann und kein anderer. Ich brauchte zum Beispiel heute nur in meinen Schrank zu greifen, um die Kleider herauszunehmen, in denen ich mich Ihnen heute präsentiere. Von Schwestern und Teilnehmerinnen von Wohngemeinschaften habe ich schon Horrorgeschichten gehört, wie Dinge, die sie zu einem wichtigen Termin tragen wollten, im entscheidenden Moment nicht da waren, weil die liebe Schwester oder Freundin sich ohne zu fragen oder auch nur Bescheid zu sagen, selbst bedient hatten. Bei mir stimmt im Allgemeinen der Satz, den meine Mutter immer auf die Frage „Wo ist denn…“ zur Antwort gab: „Dort, wo du es hingelegt hast!“ Das ist eine Wahrheit, die in manchen Situationen sehr beruhigend sein kann.
Ich finde es auch gerecht, dass ich über meine Kleidung, meine Küchenschere, meine Bücher selbst verfügen kann. Schließlich habe ich dafür Geld ausgegeben, das mir für Arbeit, die ich geleistet habe, bezahlt wurde. Damit vergüte ich die Arbeit eines anderen, der die Gegenstände, die ich besitzen möchte, gefertigt hat und der sich davon wieder Dinge seiner Wahl kaufen kann. Ein sinnvoller Kreislauf. Es gibt noch einen anderen Weg: Eine Freundin von mir hat wunderschöne Pullover, die sie sich selbst gestrickt hat. Auch in diesem Fall ist ihr Besitz eine Folge einer vorausgegangenen Leistung. Ich denke, die Mehrheit teilt mein Gerechtigkeitsempfinden, dass es richtig ist, wenn jeder die Früchte seiner eigenen Arbeit nach eigenem Gutdünken genießen kann. Klammern wir einmal das Problem aus, unterschiedliche Arbeiten zu vergleichen und einen „gerechten Lohn“ zu finden. Und auch den Sonderfall, dass jemand von der Arbeit eines anderen profitiert, finden wir wohl alle in Ordnung, wenn es sich um ein freiwilliges Geschenk handelt.
Doch die Begründung von Gut gegen Leistung kommt irgendwann an ein Ende. Nehmen wir als Beispiel das Brot. Wenn ich es kaufe, bezahle ich die Leistung des Bäckers. Doch nicht diese allein, denn im Preis inbegriffen ist, dass der Bäcker Mehl, Gewürze und Triebmittel kaufen und die Leistung der Produzenten vergüten musste. Der Müller wiederum musste die Bauern bezahlen, die das Korn geliefert haben. Doch das Korn konnten die Bauern nicht allein kraft ihrer Arbeit produzieren, obwohl harte Arbeit durchaus dazu nötig ist. Genauso unerlässliche Komponenten aber sind der Boden und das Klima und die vorgefundene genetische Struktur der Kornpflanzen. Wenn die Kommunisten sagten: „Ohne Gott und Sonnenschein holen wir die Ernte ein!“ so weiß jeder denkende Mensch, dass das - zumindest im Hinblick auf den Sonnenschein - purer Unsinn ist. Wenn wir die Produktionskette anderer Güter zurückverfolgen, bin ich sicher, dass wir auch dort schließlich immer an einen Punkt kommen werden, wo etwas, das von Natur aus ohne jedes menschliche Zutun schon da ist, die unerlässliche Grundlage des ganzen Prozesses bildet. Doch da diese Komponenten nicht von Menschen erstellt werden, sollte man erwarten, dass wir auch nichts dafür zahlen müssen
Unsere Wirtschaftsordnung sieht allerdings anders aus: Ein Großgrundbesitzer, der selbst bei der Bewirtschaftung seiner Felder in keiner Weise mit Hand anlegt, darf erwarten, dass allein der Besitz des Landes ihm Geld einbringt, wenn er es anderen zur Bewirtschaftung zur Verfügung stellt. Wieso kann etwas, das von Natur aus da ist, das Eigentum eines einzelnen Menschen sein? Er mag es gekauft haben, so wie ich das Brot. Doch wer hatte denn ein Recht, es ihm zu verkaufen?
Aus der Ethnologie wissen wir, dass Naturvölker im Allgemeinen kein Eigentum an Grund und Boden kannten. Die Natur wurde als unverfügbar angesehen oder der urbare Boden gehörte der Sippe als ganzer. Das scheint sich erst im Zuge der Eroberungskriege gewandelt zu haben. Es gab ja nicht nur die germanische Völkerwanderung - bei uns „die Völkerwanderung" genannt - sondern davor schon die 1. und 2. Indoeuropäische Wanderung und die große Wanderungsbewegung der Kelten. Ganze Völkerschaften verließen ihr angestammtes Gebiet, wahrscheinlich weil es durch Klimaveränderungen oder Geburtenüberschüsse nicht mehr genug Lebenschancen für alle bot. Sie vertrieben, wenn sie dazu in der Lage waren, andere Völker aus deren Gebiet. Deren Land wurde dann aufgeteilt, nicht immer gleichmäßig, sondern oft mit größeren Landstücken für diejenigen, die sich in diesen Kämpfen besonders hervorgetan hatten. In den späteren Raubzügen wurde oft mehr Land an einen einzelnen gegeben, als dieser mit seiner Familie bewirtschaften konnte. In diesen Fällen wurden die alten Einwohner nicht vertrieben, sondern als Sklaven, Leibeigene oder Hörige gleich mit verteilt. Und diese Großgrundbesitzer haben dann die ganze Wirtschaftsordnung maßgeblich geprägt. Noch nach Abschaffung der Leibeigenschaft saßen sie am längeren Hebel, da sie Möglichkeiten hatten, andere von der Nutzung des Landes auszuschließen, das sie selbst nicht bewirtschaften konnten. Das wiederum hieß, dass sie es mit eigenem Nutzen verpachten konnten. Fazit: Die Leistung, der die Eroberer und deren Nachkommen ihre günstige Ausgangslage verdankten, war eine kriegerische, um nicht zu sagen: erfolgreicher Raub. Daher halte ich es moralisch für zulässig, wenn ein Volk diese Eigentumsregelungen und –verteilungen ändert, sofern es zu dem Schluss kommt, dass damit der Allgemeinheit besser gedient ist.
Was kann man schon zur Verteidigung des Prinzips anführen, dass Räuber ihre Beute behalten dürfen und das über Generationen? Ein Argument wäre, dass es sinnvoll ist, irgendwann einmal den Status quo anzuerkennen, weil sonst die Verteilungskämpfe nie aufhören und nie Frieden einkehren kann. Einverstanden. Doch das ist ein Argument der Zweckmäßigkeit, nicht der Moral. Moralisch könnte man den Erwerb durch Kampf, bei dem man immerhin auch das eigene Leben in die Waagschale wirft, als Leistung anerkennen, die Fakten und damit positives Recht schafft. So haben das diese wandernden Völker wohl auch empfunden. Doch wenn Macht Recht schafft, wäre es nach diesem Maßstab auch gerecht, bei neuen Machtverhältnissen auch die Besitzverhältnisse zu verändern.
Wenn wir aber Eigentumsrechte anders begründen wollen, wenn wir sagen, Diebstahl und Raub sollten geächtet sein, die Täter verfolgt und die Beute den früheren Eigentümern zurück gegeben werden, weshalb sollte man die Ergebnisse früherer Machtverhältnisse für unantastbar halten?
Natürlich vermischen sich die Dinge in der Realität. Wenn jemand eine Sache in der geltenden Rechtsordnung als sein Eigentum betrachten darf, so gibt er sich vielleicht besondere Mühe, sie pfleglich zu behandeln und ihren Wert zu erhalten. Damit erbringt er eine Leistung und die müsste bei einer moralisch zu rechtfertigenden Änderung der Eigentumsordnung irgendwie entgolten werden. Doch der Maßstab wäre dann die bereits erbrachte Arbeit oder Investition, nicht ein Marktwert, den es in der neuen Ordnung vielleicht gar nicht gäbe und keine Vorausverzinsung zukünftiger
Erwartungen.
Ich will damit nun nicht sagen, dass eine Gleichverteilung oder Vergesellschaftung aller Naturgüter die Ideallösung aller wirtschaftlichen Probleme wäre. Als gerecht würde ich sie schon empfinden. Doch werfen sich dann ganz neue Fragen der Zweckmäßigkeit auf. Im Sinne der Nachhaltigkeit könnte sich eine solche Umver-teilung sogar als kontraproduktiv erweisen. Nur moralisch gesehen empfinde ich das Eigentum nicht als sakrosankt. Allerdings betrachte ich es als wünschenswert, dass es klare Regeln dafür gibt, womit ein Mensch selbst nach Gutdünken oder auch unter gewissen Auflagen schalten und walten darf und dass diese Regeln für alle gleicherweise gelten.